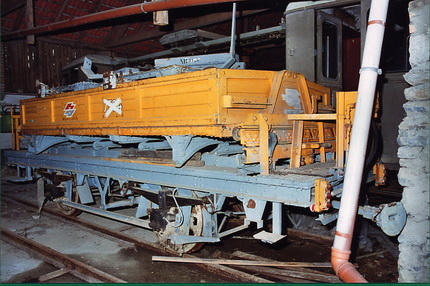Fahrzeuge der Wiener Straßenbahn
II.
Am Anfang stehen die Gedanken
Wie es in den meisten Fall aussah und
ausging…
Manch ein
Straßenbahnfreund (-innen kenne ich keine!) hat schon mal den Wunsch
gehabt, zumindestens eines der geliebten Fahrzeuge für sich zu erwerben.
Dabei steht zumeist der RETTUNGS-Gedanke im Vordergrund, denn es geht in
so gut wie allen Fällen um vor der Ausscheidung und damit der
Verschrottung stehende Wagen.
Tritt solch ein Fan
derartigen Gedanken auch nur irgendwie konkret näher, stehen mehrere
Probleme schlagartig wie eine Wand vor dem armen „Denker“:
|
+
Die
KOSTEN des ERWERBES: sind
kein wirkliches Problem verglichen mit den anderen Soll heißen: nach und nach mussten sie alle vom Netz gebracht werden. |
|
+
Damit ist klar: das fiktiv erworbene Fahrzeug müsste
ABTRANSPORTIERT werden.
Verursacht so
ein
Transport schon mal enorme Kosten, so ist das doch noch das
weit
geringere Problem.
So, das war’s dann mit den
allermeisten derartigen Ambitionen. |
III.1. Die zeitliche Abfolge des Sammlungsbeginns
|
1983:
Ein erster erfolgloser Versuch Um diese Zeit
war ich noch Student mit einem Taschengeld von
umgerechnet 109 Euro/Monat. Damals wurde ein MH
(ex Fahrzeugtype M) nach dem anderen auf das Schrottgleis hinter der
Zentralwerkstätte Simmering geschoben. Mein damaliger Liebling stand auf
dem Freigelände im Bahnhof Favoriten und war dementsprechend schon
witterungsgeschädigt. Ich wollte jedenfalls diesen 6321 (Ex M 4094)
unbedingt vor der Verschrottung bewahren. Aber keine Chance: selbst eine
Intervention von sehr, sehr hoher Stelle, die ich organisieren konnte,
brachte keinerlei Erfolg. Erwerb ja, aber dann umgehend weg vom Netz und
aus! Und so gibt es den armen MH 6321 heute leider nicht mehr! |
|
|
1986:
Noch kein Erfolg, aber es gibt
schon Licht am Ende des Tunnels Im Sommer des
Jahres gab es einen bebilderten Artikel in der Zeitung „Schienenverkehr
aktuell“, der die noch in Wien abgestellten Wagen eines nicht mehr
in Erscheinung tretenden ehemals „legalen“ Straßenbahnfreundevereines
zum Inhalt hatte. Der Autor wies darauf hin, dass diese Fahrzeuge akut
von der Zwangsverschrottung bedroht seien. Einer der Wagen war der
K-Triebwagen 2426 (siehe auch: „Der Verein“). Also habe ich mich ans
Telefon geklemmt und den damaligen Leiter des Wiener Straßenbahnmuseums
angerufen. Antwort: Man kenne diese Wagen und die WVB würden schon
entsprechend handeln. An Privaten, die sich da einmischen, bestünde
keinerlei Bedarf. Also wieder nichts. Aber von nun an begann mich der
Gedanke der Fahrzeugrettung nicht mehr loszulassen. |
Von 1987 an:
Nun geht es ans HANDELN Über
Verbindungen erfuhr ich, dass der letzte alte Schienenschleifwagen 6051
auf den Schrottplatz der damaligen Verwertungsfirma Eltschka am
Franzosengraben gebracht werden würde. Nachdem abgeklärt worden war,
dass das Fahrzeug einige Zeit dort stehen bleiben dürfe, habe ich diesen
Wagen dem Schrotthändler teuer abgekauft. Nachdem ich den Besitzer des K
2426 ausfindig gemacht hatte, kaufte ich auch diesen noch am WVB-Netz
befindlichen Wagen unter Aufnahme eines Kredites bei der längst dahin
geschiedenen Zentralsparkassa („Z“). Der arme 2426 hatte aber KEINE
Erlaubnis, am Netz zu verbleiben, was mir kurze Zeit später ein Brief
der durch die Meldung des Verkaufes aufgescheuchten WVB-Chefetage
deutlich klar gemacht hat – „…müssen
wir auf der Entfernung des Fahrzeuges binnen sechs Wochen bestehen…“. |
|
|
 |
 |
|
Bild oben: So sah der 2426 bei der
Übernahme aus Foto : Horst Christian |
Die „geretteten“ Waggons auf dem Areal der späteren Müllumladestation Mödling. Bei genauerer Betrachtung sieht man, dass die Vandalen ihr Werk schon begonnen haben. Foto: Leitzmüller |
+ vom Schrotthändler Eltschka am Franzosengraben
+ von den Besitzern der
Altwagen, die auf Spielplätzen Spitalsarealen etc. aufgestellt waren


K 2307 (falsch nummeriert als 2402) in Litschau:
links bald nach der Lieferung (Foto: Gerhard Winkler)
und rechts vor der Übernahme durch uns etwa 14 Jahre später.
So gut wie
alle der in Rede stehenden Wagen waren zum Zeitpunkt ihres Erwerbes akut
bedroht. Sei es durch den drohenden Verlust des Aufstellungsortes, sei
es allein schon durch den schrecklichen Zustand, in dem sich gerade die
Wagen befanden, die Jahre der Freiabstellung hinter sich hatten.
|
Personentriebwagen: HR 6154 (ex H1
2237): wurde schwer witterungsgeschädigt vom Grazer Tramwaymuseum
übernommen Von einer
Privatperson aus unserem Verein erworbene NICHT direkt museumsrelevante
Fahrzeuge: M 4113, MH 6308 (ex
M 4142), letzterer als Tauschobjekt für den sz3
7222 (ex k3
1622) aus dem Motorradmuseum Eggenburg (siehe unten) |
sz1
7166 (ex d2
5085): vom Grazer Tramwaymuseum erworben sz3 7222 (ex k3 1622): vom Motorradmuseum Eggenburg erworben (siehe oben), Diese vier Wagen hatten als Salzwagen überlebt. Der Zustand war entsprechend: Salz, Rost und Dreck auf nahezu jedem cm2!
l 1711, 1758, l3
1896 m3
5325: aus Pöggstall erworben (siehe oben) |
Bild oben: Der
unter Verlust seiner Inneneinrichtung zum Salzwagen umgebaute ehemalige
Personenbeiwagen sz3
7204 im Wintereinsatz
1986/87.
Im Sommer 1987 haben wir den Wagen übernommen.
|
Arbeitstriebwagen: SP 6010,
6014, 6045 |

Bild: Sommer 1987, Schrottplatz der Firma
Eltschka.
|
|
Arbeitsbeiwagen: gm 7064,
7066, 7069 |
Bild oben: ko1 7504 mit den beiden st beladen steht - nach dem Erwerb durch uns - sicher unter Dach abgestellt. |
Wir haben also
nicht gekleckert sondern geklotzt, was den Fahrzeugerwerb betrifft.
Etliche Fahrzeuge haben wir dann – immer kostenlos! - an neue Eigentümer
abgegeben, die sie zwischenzeitlich ihrerseits schon vielfach
restauriert haben.
V. Fahrzeugtransporte
|
Anfang der
90er-Jahre machten wir dann Nägel mit Köpfen. Wir kauften den
Mariazellern den Roller ab und erwarben eine ausgeschiedene
SAURER-Zugmaschine des KWD-Liesing, Baujahr 1958. Beide Fahrzeuge wurden
nach einer gründlichen Überarbeitung samt Überprüfung angemeldet und
leisteten uns gute Dienste. In Hinkunft konnten wir unsere Transporte
also in Eigenregie durchführen.
|
|
VI. Fahrzeugrestaurierungen
Da ist man
nun auf einmal Fahrzeugbesitzer. Genau genommen: mehr oder weniger
„Wrackbesitzer“. Die vierrädrigen Lieblinge sind teilweise inkomplett
und weisen außerdem erhebliche Witterungsschäden auf.
|
Die
Basisanforderungen für den Restaurierungsbeginn in der Halle waren nun: + Im Gebäude
musste eine Werkstatt mit den nötigen Werkzeugen eingerichtet werden Damit könnten
dann alle Arbeiten durchgeführt werden, die in unserer Halle möglich
waren. Das waren nahezu sämtliche Sanierungsarbeiten an den Wagenkästen
(+ Dächer und Innenräume). |
|
|
Die
weitergehenden Anforderungen zur Fertigstellung: Unser ehrgeiziges
Ziel, aus den Wracks VOLLKOMMEN sanierte und damit FAHRBEREITE Fahrzeuge
zu schaffen, konnte in unserer Halle natürlich nicht zur Gänze erreicht
werden. Hier gelang uns ein großer Durchbruch. SR DI Josef Michlmayr
(damals Gruppenleiter der Zentralwerkstätte in Simmering) gestattete es
uns, die in der Halle teilsanierten Wagen zur Endfertigung in die
damalige Zentralwerkstätte (heute Hauptwerkstätte) zu bringen. Dort wurden dann
die Fertigstellungsarbeiten in Lohnarbeit durchgeführt: o Ausbinden
der Triebsätze und vollkommene Sanierung derselben, teilweise sogar mit
Motortausch |
|
|
Auf
diese Weise wurden zwischen 1990 und 2005 folgende Wagen komplett
restauriert:
x H1
2237 mit entsprechenden „Wü“-Pickerln sowie Messkarten nach durchgeführter Abnahmefahrt überprüft übergeben. |
 |
KH 6377 (ex K 2307): siehe
oben. Wurde Anfang der 2000er-Jahre von der Mariazeller Museumstramway
übernommen und wunderbar in Zustand von 1927 rückversetzt.
L1
2625: kam 2005 nach Wehmingen (bei Hannover) zum Hannover’schen
Strassenbahnmuseum (HSM). Wurde dort mittlerweile aufgearbeitet und ist
häufig fahrend im Einsatz.
sz3
7204 (ex k3
1604): kam 2006 zum HSM, wurde dort bereits teilrestauriert
m3
5325: kam 2006 zum HSM, ist mittlerweile bereits restauriert und wird im
Fahrbetrieb eingesetzt
SP 6010: kam über die
Vermittlung der Mariazeller Museumstramway nach Osteuropa
SP 6014: befindet sich heute im
Rekonstruktionszentrum Traiskirchen des WTM
KO
6131: kam 2006 zum HSM
GP 6418: befindet sich
heute im Rekonstruktionszentrum Traiskirchen des WTM
gm 7064: ist heute bei der
Amsterdamer Museumstramway (gemeinsam mit 6011 und 7053) und wurde dort
hervorragend aufgearbeitet
gm 7066: kam nach
Frankreich (Generatorwagen für M 4098): Verbleib: ?
gm 7069: wurde von Ing.
Rietsch übernommen: Verbleib: ?
kt 7132: heute
Museumstramway Mariazell
ko1
7504: kam 2006 zum HSM
ko3
7517: Verbleib: ?
st: 7119 und 7120: kamen
2006 zum HSM
kl: 7531, 7532, 7533 – heute
alle Museumstramway Mariazell
Als ein Beispiel für eine gelungene
Sanierung behandeln wir hier den
K 2311
|
|
|
Bedeutung für
die Sammlung des Mödlinger Stadtverkehrsmuseums:
2311 war als einer der Stammwagen des Bahnhofes Breitensee in den
50er-Jahren oftmals Sonn- und Feiertagsaushelfer auf Linie 360. Als
K-Wagen in Neukastenversion ist er ein wichtiges Fahrzeug in unserer
Sammlung.
|
Wir
schreiben Anfang Jänner 1988: Der Verein „MStM“ ist ein halbes
Jahr alt. Es ist die Zeit, in der wir alle paar Wochen voller
Elan irgendein neues Fahrzeug erwerben. Und nun Hirtenberg: dort
soll sich seit vielen Jahren auf einem Spielplatz der K-
Triebwagen 2311 (noch nummeriert als Hilfswagen KH 6378)
befinden. In den 70er-Jahren (teilweise auch noch in den 80ern)
war es Mode, ausgediente Straßenbahnwagen auf Spielplätze zu
stellen, um sie dort in der Regel mehr oder minder verrotten zu
lassen. Gesagt, getan - hinein ins Auto und wirklich, kurz nach
der Ortseinfahrt ist rechter Hand ein Kinderspielplatz, der
übrigens heute längst verbaut ist. Zwischen diversen
Spielgeräten steht tatsächlich das neue Objekt unserer Begierde.
Ein erster Blick: Gott sei Dank ist das Fahrzeug ziemlich
komplett, Motoren, Schienenbremsen und sämtliche Dachaufbauten
sind noch vorhanden (das ist für Spielplatzwagen keineswegs
selbstverständlich!). „Komplett“ ist für solch einen Waggon
natürlich ein relativer Begriff, denn natgürlich fehlen
ungezählte kleinere Teile. Vieles ist zu sehen, was uns jedoch,
„grün“ wie wir sind, nicht auffällt: eine rissige, teilweise in
Fetzen herunterhängende Segeltuchdachhaut, viele Faulstellen am
Holz, besonders im Dach- und Vorbaukranzbereich der Plattformen
und ein verdächtig gebuckeltes, sichtlich feuchtes Innendach.
Als mich ein Vereinskollege fragt, wieviel man in das Fahrzeug
wohl werde investieren müssen, bis es wieder wie neu sei, sage
ich, meiner eigenen Wichtigkeit und Erfahrung wohl bewußt: „Na
ja, mit fünfzigtausend Schilling müssen wir schon rechnen!“ Wenn
ich heute - 33 Jahre später und gezeichnet von 18 Jahren
Sanierungserfahrung – an diese tiefschürfende Kostenanalyse von
1988 denke, muß ich über meine grenzenlose Naivität von damals
lachen! K 2426, unsere Ersatzteile und das Gerümpel des Wirtschaftshofes regelrecht hineinzwängen müssen. |
|
|
Dass das
„Hineinzwängen“ wörtlich zu nehmen war, zeigt dieses Bild aus dem Sommer
1988 anschaulich. Erst im nächsten Jahr sollte der Wirtschaftshof samt
seinem Gerümpel die Halle räumen. |
 Foto: Ing. Eugen Chasteler. |
|
Noch keine Rede ist von irgendwelchen
Sanierungsleistungen, wir machen uns lediglich daran, den
frisch erworbenen Schatz einmal einer
näheren Inspektion zu unterziehen. Für die Entfernung
erheblicher Teile der Dach- und Vorbaukränze brauchen wir
keinerlei Spezialwerkzeug, da genügen Kaffeelöffel (siehe Bild
rechts).
|
 Bild: Der Dachkranz einer Plattform vor Beginn der Sanierung. |
|
Der Innenraum
stellt sich bei näherer Untersuchung als ziemlich verrottet heraus, eine
Sitzbank wurde regelrecht aus der Verankerung gerissen.
Alles in allem – ein Wrack. Noch Jahre später sollte einer unserer
Tischler sagen: „2311 ? – Benzin
drauf und anzünden!“. Und das, nachdem wir bereits einige Wagen
restauriert hatten! In den 90er-Jahren
kommen unsere ersten Sanierungserfolge. Ende 1992 mache ich den
Tischlern den Vorschlag, 1993 mit der Aufarbeitung des 2311 zu beginnen.
Doch die lehnen das als zu großes Unterfangen ab, sodass KO 6132 in
Angriff genommen wird. 1993 erwerben wir mit dem HR 6154 (ex H1
2237) den ersten und vermutlich einzigen Wiener Laternendachtriebwagen
unserer Sammlung, doch ist der in ähnlichem Zustand wie der 2311. Nun
machen sich die Herren jedoch voller Elan an die Rekonstruktion des
neuen Gefährtes, die über weite Strecken einem Kastenneubau gleichkommt.
Im Juni 2001 kann der 2237 fertig restauriert in der ZW der Wiener
Linien in Betrieb genommen werden. Mit dieser Großrekonstruktion ist der
Bann sozusagen gebrochen und nach zwei erfolgreichen Beiwagensanierungen
(1613 und 1622) erklären sich die Herren Ende August 2000 bereit, mit
dem „großen Brocken“ 2311 zu beginnen. Unser Tischler Eduard Dvorak
befindet sich zu dieser Zeit im 76. Lebensjahr. Drei Jahr lang wird er
nun sein Lebenswerk krönen! Schon bald
nach Beginn der Arbeiten wird klar, dass diese Rekonstruktion noch
wesentlich aufwendiger sein würde, als die des H1
2237. |
 Bild oben: Zu Beginn der Sanierung war das angefaulte Holz zu entfernen |
| Eine
Kastenecksäule ist ebenso zu tauschen, wie die kompletten
Vorbau- und Dachkränze und das gesamte äußere Waggondach. Im
weiteren sind neu anzufertigen: Plattformfußböden, sämtliche
inneren Schalungshölzer, alle großen Holzfenster, alle Sitze,
das Innendach, sowie die gesamte Verblechung, etc..Eine neue
Segeltuchdachhaut wird natürlich auch aufgebracht werden, und
die hölzernen Dachaufbauten müssen sämtlich erneuert werden.
|
Bild unten: Die Reparatur ist in vollem Gange
|
|
Die gesamte
Verglasung wird durch Sicherheitsglas ersetzt. Von den 12 Klapp- und 2
Blindtüren bleiben nur Gerippe über, die dann natürlich mit neuen
Elementen komplettiert werden müssen. |
 Bild des Innenraumes während der Aufarbeitung.
|
|
Selbstverständlich muss auch alles Fehlende und Defekte (wie u.a. Schienenbrems- und Winkerschalter) am Fahrzeug ersetzt werden, was uns dank unseres gut sortierten Ersatzteillagers möglich ist. In weiten Bereichen muss 2311 natürlich auch neu verkabelt werden. Diese Arbeiten füllen die Jahre 2000 bis 2003 aus. Am 8.
November 2003 kann 2311 zur Fertigstellung in die
Zentralwerkstätte der Wiener Linien überstellt werden. |
 B ild oben: Diese demontierten Teile kommen zur Aufarbeitung |
|
Dort wird – wie das bisher bei
allen unseren sanierten Wagen geschehen ist – der gesamte
Untergestellbereich einer gründlichen Revision unterzogen
werden. Arbeiten dieser Art sind in unserer Halle nicht
durchführbar, deswegen sind wir der ZW für ihr Entgegenkommen
sehr dankbar. |
|

Die Befundung ergibt, dass 2311
nicht nur punkto Wagenkasten ein Wrack war, sondern auch schwere
Schäden im Untergestellbereich vorhanden sind. Bei einem der
Motorzahnräder sind die Zacken auf Briefpapierdicke (!)
zusammengeschliffen, Schäden gibt es an quasi allen Lagern, an
den Schienenbremshobeln, und sogar die Ringe für die
Kastentragfedern sind defekt und müssen getauscht werden. Es ist
für das heutige „Leben“ des 2311 äußerst günstig, dass ich das
vorher nicht gewusst habe.
|
|

Am 8. November 2005 kann der Wagen in der Zentralwerkstätte der Wiener Linien fahrbereit präsentiert werden. Zu Gast ist bei dieser kleinen Feier der VEF, der mit dem Dreiwagenzug 2447-1627-1630 in die ZW kommt. Die eigenen k3 1613 und 1622 aus Mödling zu bringen, war für uns aus Kostengründen leider keine Option. Aber auch so ist es ein Supertag, an dem sich 2311 auch im Dreiwagenzug bewähren darf, und die Kameras rauchen, so viele Bilder werden geschossen.
Ich möchte diesen
Bericht nicht beschließen, ohne den Herrn Adamek senior und junior,
Herrn Springer, Herrn Koll sowie den zuständigen Mitarbeitern der ZW der
Wiener Linien für ihre gute Arbeit herzlich gedankt zu haben! Unser
großartige Tischler, Herr Eduard Dvorak, hat dieses
Event
leider nicht mehr erleben dürfen. Er ist einige Monate vorher völlig
unerwartet gestorben!
| Homepage | Vorwort | Übersicht | Verkehrsgeschichte Mödlings | Verein | Fahrzeuge | Infos Museum | Öffnungszeiten | Publikationen | Ehrentafel | Links in Arbeit |
Archiv | Impressum |